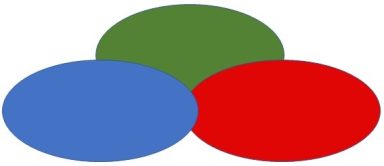Vom Wert der Natur bis zum Preis
Naturgrundlage, Arbeit, Bedarf, Wert, Preis, Assoziation, Geld
Bernhard M. Huber, März 2025
Natur, Arbeit und Wert
Die Natur ist im Grunde ein riesiger Geschenkkorb. Solange man aber diesem Korb nichts entnimmt, bleiben die Geschenke im volkswirtschaftlichen(!) Sinn wertlos. Erst wenn man Arbeit aufwendet um z.B. Erdöl zu fördern, bekommt dieses Erdöl einen Wert und je weiter durch Arbeit dieses Erdöl zu weiteren Produkten verfeinert wird (Sprit, Kunststoff etc.), umso wertvoller wird das jeweils entstehende Produkt.
Damit sind die Begriffe Naturgrundlage, Arbeit und Wert bereits richtig eingeordnet: Werte entstehen durch Arbeit auf Natur (als Arbeit für andere!) – aber nicht nur! Der Wert eines Produktes hängt auch von dessen Verfügbarkeit ab, aber ganz besonders vom Bedarf. Wenn es für ein Produkt keinen Bedarf gibt, hat es keinen Wert – die geleistete Arbeit wäre dann vergeudet. So gesehen hat es für einen Landwirt nur dann Sinn im Frühjahr Kartoffeln zu setzen, wenn er weiß, dass er diese im Herbst auch verkaufen kann, also der Bedarf gesichert ist. Das gilt auch für Erdölförderung und jede andere materielle Produktion.
Zur Beschaffung des Rohmaterials, dessen Verfeinerung, also zur gesamten Produktionssteuerung, muss ein bestimmtes Wissen vorhanden sein. Dieses Wissen eignen wir uns durch Schule und Ausbildung an. Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind also rein geistige Phänomene. Das heißt: Jeder Arbeiter arbeitet immer auch aus seinen geistigen Fähigkeiten heraus – er wendet seinen Geist auf Arbeit an und erzeugt so den bekannten Mehrwert. Das gilt natürlich auch für eher unspektakuläre Arbeiten wie etwa fürs Fensterputzen!
Was wir allerdings noch nicht beachtet haben, ist, dass alles was wir der Natur entnehmen, dort eine Lücke hinterlässt, welche sich nicht mehr schließt. Mit anderen Worten: Die Natur reproduziert die ihr entnommenen Produkte nicht – der Geschenkkorb wird immer leerer! Dieser Umstand erfordert eine weitere, geistige Leistung: Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist eine Geisteshaltung, welche ein menschen- und naturwürdiges Verhalten als Voraussetzung für unser aller Wohlergehen zum Ziel hat.
Denn von der menschlichen Brüderlichkeit können wir nur dann sprechen, wenn wir den andern Menschen in uns tragen wie uns selber.(1)
Bedarf, Wert und Preis
Nun haben wir aus dem Erdöl (als Beispiel) eine wertvolles Produkt erarbeitet, für das es auch einen Bedarf gibt:
Die Wirtschaft liefert Güter für den Konsum. […] Diese Güter sind Werte, weil ein Bedürfnis nach ihnen besteht. Den volkswirtschaftlichen Wert kann man als Spannungszustand beschreiben, indem man sagt: Auf der einen Seite steht das menschliche Bedürfnis […] Auf der anderen Seite steht das Gut in seiner Qualität […] (2)
Wie kommen wir nun zum Preis? Die Antwort ist nicht ganz einfach.
Worüber wir uns aber als erstes klar sein sollten, ist, wie der Preis nicht festgelegt werden kann: Nicht durch demokratische Entscheidungen – also per Gesetz. Auch nicht individuell, jeder für sich und willkürlich, aber das ist eher selbstverständlich. Also kann der Preis nur zwischen jenen verhandelt werden, die die Produkte herstellen, verteilen und konsumieren: Produzenten, Händler und Konsumenten. Es kann sich also nur um Entscheidungen ganz konkreter Gruppen handeln!
Damit sind wir beim Kern der autarken und brüderlichen Wirtschaft der Dreigliederung angekommen, der Assoziation als wirtschaftliche Urzelle (Rudolf Steiner GA 331). Assoziationen sind vielfach vernetzte Gruppen von Produzenten, Händlern und Konsumenten. Dort – und nur dort! – artikuliert sich der Bedarf, die Art der Produktion und letztlich der Preis.
Hier wird nochmals deutlich, welche zentrale Bedeutung die Assoziationen haben:
Innerhalb einer Assoziation kann aus Fachkenntnis und Sachlichkeit eine weitgehende Harmonie der Interessen herrschen. Nicht Gesetze regeln die Erzeugung, die Zirkulation und den Verbrauch der Güter, sondern die Menschen aus ihrer unmittelbaren Einsicht und ihrem Interesse heraus. […] Es werden Handarbeiter mit den geistigen Leitern der Produktion und mit den konsumierenden Interessenten des Produzierten zusammenwirken, um durch Preisregulierungen Leistungen entsprechend den Gegenleistungen zu gestalten. Das kann nicht durch Parlamentieren in Versammlungen geschehen.(3)
Die Grundlage der Preisgestaltung
Nur […] im freien Zusammenwirken der drei Glieder des sozialen Organismus, wird sich als Ergebnis für das Wirtschaftsleben ein gesundes Preisverhältnis der erzeugten Güter einstellen. Dieses muss so sein, dass jeder Arbeitende für ein Erzeugnis so viel an Gegenwert erhält, als zur Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse bei ihm und den zu ihm gehörenden Personen nötig ist, bis er ein Erzeugnis der gleichen Arbeit wieder hervorgebracht hat. Ein solches Preisverhältnis kann nicht durch amtliche Feststellung erfolgen, sondern es muss sich als Resultat ergeben aus dem lebendigen Zusammenwirken der im sozialen Organismus tätigen Assoziationen.(3)
Steuerung der Preise
Was können die Assoziationen tun, wenn sie feststellen, dass Preise zu hoch oder zu niedrig sind? Wenn sie zu niedrig sind, so dass die produzierenden Menschen nicht davon leben können, heißt das, dass durch zu viele Menschen zu viel produziert wird. Dann ist es Aufgabe der Assoziationen, dafür zu sorgen, dass Menschen in andere Produktionszweige umgeleitet werden, nicht zwangsweise, sondern durch eine geeignete Stellenvermittlung. Heute geschieht das auch, aber chaotisch und mit viel Leid, wenn in einem Wirtschaftszweig der schwächste Betrieb Konkurs macht. Heute muss der Staat die Arbeitslosen auffangen mit Arbeitslosengeld und mit der staatlichen Stellenvermittlung. Das sind aber ganz klar Aufgaben des Wirtschaftslebens.(4) [Autor: Rudolf Isler, Bezug nehmend auf Rudolf Steiner, GA333]
Es zeigt sich nun der fundamentale Unterschied zwischen der assoziativen Wirtschaft und der heutigen Marktwirtschaft, wo die Preiskonkurrenz als die wichtigste regulierende Kraft gilt:
Wenn man in dieser Weise [assoziativ] den Preis bestimmen kann, wenn man wirklich auf dem Wege der Zusammenschließung der [verschiedenen] Branchen den Preis bestimmen kann, da hört die Konkurrenz nämlich auf.(5)
Zwischenbemerkung: Warum sind heute die Preise falsch?
Wenn die Lebensmittelpreise von den Pachtgebühren für die Ackerflächen abhängen, der Wert und damit die Pacht der Flächen durch Spekulation ständig steigt, dann bezahlt der Kunde auch den Spekulationsgewinn des Eigentümers: Die Preise sind also zu hoch.
Andererseits: Wenn Lebensmittel durch massiven Einsatz von Kunstdünger, Herbiziden und Pestiziden massenhaft und billig hergestellt werden können, dann sind deren Preise zu niedrig, weil der entstehende Schaden an der Natur und unserer Gesundheit nicht über den Preis sondern durch die verallgemeinerten Kosten (Wasserreinigung, Krankheitskosten) bekämpft werden. So gesehen ist billiges Gemüse tatsächlich viel teurer als das teure Demeter-Gemüse.
Was ist Geld?(6)
Diese Frage mag zunächst eigentümlich klingen, die Antwort ist aber wichtig, denn Geld kann auch missbräuchlich verwendet werden. Geld aus Sicht der Dreigliederung:
Geld kann im gesunden sozialen Organismus nichts anderes sein als eine Anweisung auf Waren, die von andern erzeugt sind und die man aus dem Gesamtgebiet des Wirtschaftslebens deshalb beziehen kann, weil man selbst erzeugte Waren an dieses Gebiet abgegeben hat.
Da wird […] nicht mehr die Staatsverwaltung das Geld als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen haben, sondern diese Anerkennung wird auf den Maßnahmen beruhen, welche von den Verwaltungskörpern der Wirtschaftsorganisation ausgehen.(3)
Geld ist also ein Tausch- und Zirkulationsmittel (Geld gegen Ware) dessen Anerkennung nur dort sichergestellt werden kann, wo es genutzt wird – im Wirtschaftsleben.
Was ist Geld nicht?
Wenn Geld aufbewahrt wird, verliert es die notwendige Zirkulationsfunktion und kann den gesamten Wirtschaftskreislauf stören – ganz abgesehen von der Machtanhäufung bei jenen, die große Mengen von Geld zurückhalten und z.B. in Aktien oder Grund und Boden „parken“.
Geld […] ist ein Zirkulationsmittel und kann seinen Wert auch nur durch Zirkulation aufrecht erhalten. Fällt es aus der Zirkulation heraus, weil es gehortet wird, so nimmt sein Wert sukzessive ab.(7) Hat man ein Verfahren, dass Geldanhäufungen durch einen geregelten Wertverlust unattraktiv macht, dann bleibt es in der Zirkulation: Geld muss altern!
In diesem Zusammenhang muss auch festgehalten werden, dass Geld zwar den geregelten Warenaustausch ermöglicht, aber selbst keine Ware ist. Dass wir heute Geld zur Ware machen, indem wir über „Zins und Rendite“ aus Geld ohne Eigenleistung mehr Geld machen, ist die Ursache für Ausbeutung und Krieg.
(1) Rudolf Steiner GA186
(2) Alexander Caspar, Das neue Geld
(3) Rudolf Steiner, GA23 Kernpunkte der sozialen Frage
(4) Rudolf Isler, Assoziatives Wirtschaften, Verlag Goetheanum
(5) Rudolf Steiner, GA337b
(6) Rudolf Steiner, Was ist Geld? Herausgegeben und eingeleitet von Sylvain Coiplet
(7) Stephan Eisenhut, Das Geld der Zukunft, dieDrei-Sonderheft
Bernhard M. Huber
Bernhard.Huber@soziale3gliederung.com
© Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Impressum + Datenschutz
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.